Klasse — Museum: Programm
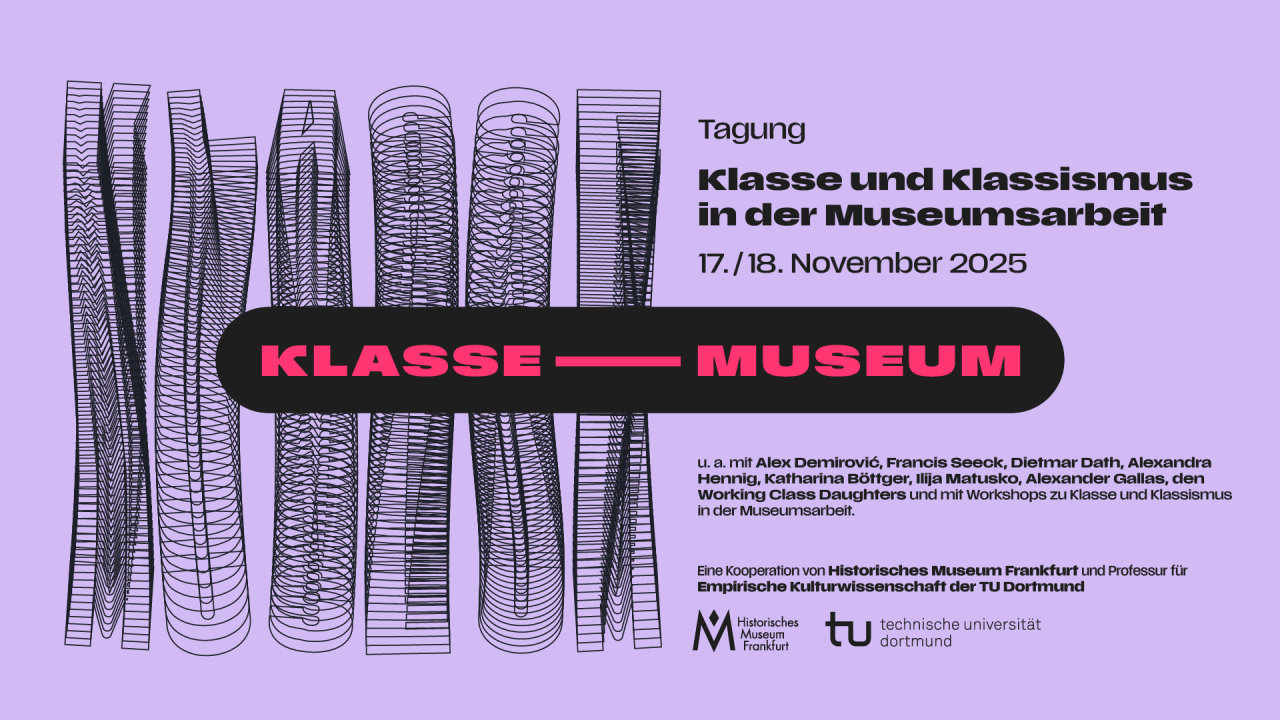
Workshops
Workshop: Klasse — Strukturen & Personal
Workshopleitung: Dominik Hünniger (Deutsches Hafenmuseum, Hamburg) & Patricia Rahemipour (Institut für Museumsforschung, Berlin)
Museen reproduzieren soziale Ungleichheit nicht nur in ihren Ausstellungen oder Sammlungen und ihrer Vermittlungsarbeit, sondern sie sind als Arbeitsorte selbst Teil gesellschaftlicher Ungleichheit. Unterschiedliche Museumsberufe haben ganz verschiedene Zugangsvoraussetzungen, werden unterschiedlich bezahlt, wertgeschätzt und sichtbar gemacht. Ebenso arbeiten Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft und Berufsbiographien in allen Arten von Museumsberufen. Selten jedoch wird sowohl das Museum als durch Klassenverhältnisse geprägter Arbeitsort als auch die soziale Herkunft von Museumsmenschen thematisiert.
Im Workshop wollen wir uns zunächst die Klassenverhältnisse in Museen vor Augen führen und darüber in den Austausch treten, wie wir innerhalb unserer Museen Sensibilitäten für Klassenfragen schaffen. Schließlich wollen wir darüber sprechen, wie durch Allianzen mit Initiativen und Institutionen außerhalb der Museumswelt unsere Museen zu besseren Arbeitsorten gemacht werden können, die Menschen jedweden Hintergrunds offen stehen.
Wir freuen uns darauf, dass ihr eure Erfahrungen, eure Kreativität und euer Wissen mit uns teilt.
Workshop: Klasse – Vermitteln
Workshopleitung: Angela Jannelli & Susanne Gesser (beide Historisches Museum Frankfurt)
Wie wirkt Klassismus im Museum? Und was kann aus der Perspektive der Vermittlung getan werden, damit Museen (noch) freundlichere und einladendere Orten werden, an denen sich „alle“ willkommen und wohl fühlen. Kann ein Museum überhaupt „alle“ willkommen heißen? Oder sollte die Museumslandschaft besser auf Differenzierung setzen?
In dem Workshop laden wir dazu ein, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und sich auf einen fiktiven Museumsbesuch zu begeben. Wo beflügelt oder behindert uns unsere Herkunft? Welchen Schwellen begegnen wir? Welche Türen sind offen, angelehnt oder geschlossen? Welche Rolle spielen freundliche Gastgeber*innen, die uns an der Tür erwarten? Und wo begegnen wir unsichtbaren Türstehern, die uns den Zugang verwehren? Was brauchen wir in unserer Rolle, um uns sicher und willkommen zu fühlen?
Aus dem Museumsbesuch möchten wir konkrete Maßnahmen ableiten, die wir als Museumsmenschen ergreifen können, damit die Hindernisse, die Herkunft und Klasse in unseren Weg legen, überwunden, umschifft oder abgebaut werden können.
Workshop: Klasse – Sammeln
Workshopleitung: Nina Gorgus & Dorothee Linnemann (beide Historisches Museum Frankfurt)
Referent*innen: Stefan Müller (Archiv der sozialen Demokratie) & Johanna Sänger (Stadtgeschichtliches Museum Leipzig)
Das Historische Museum Frankfurt ist typisch für ein Museum seiner Zeit. Es ist als Universalmuseum gegründet worden; von Gemälden, völkerkundlichen und archäologischen Objekte bis hin zu Kunsthandwerk sollte alles gesammelt werden. Auch wenn sich die Schwerpunkte im Laufe der Zeit änderten, lag doch der Fokus fast immer auf den bürgerlichen Sammlungen. In den 1980er Jahren kam Alltagskultur als neuer Bereich hinzu
Mit dem soziologisch eng gefassten Begriff „Klasse“ standen im Historischen Museum Frankfurt in jüngerer Zeit Themen der Arbeiter*innengeschichte bis hin zur aktuellen Bankenkritik (Blockupy und Occupy z.B.), im Blickpunkt des Sammelns. Eine spezifisch auf die Frage sozialer Interessen, Zusammengehörigkeiten und Kämpfe gerichtete theoretische Durchdringung sowie praktische Leitidee des Sammelns von „Klassenobjekten“ ist aber bisher nicht erfolgt. Somit stellt der Workshop die Frage: Museum und Klasse – was heißt das eigentlich? Welche Bedeutung hat das für Sammelpraktiken? Warum, wie und warum gerade heute sollten wir das umsetzen?
Der Input in diesem Panel erfolgt im Format einer Gesprächsrunde. Wir diskutieren aus der Sicht der Stadtmuseen: mit der Kuratorin Johanna Sänger aus dem Stadtmuseum Leipzig mit Sammlungsgeschichte und Expertisen aus DDR und BRD, sowie mit Stefan Müller spezifisch auf die Klassenfrage ausgerichteten Archiven wie dem Archiv der Sozialen Bewegung. Um das Prozesshafte zu unterstreichen und viele unterschiedliche Perspektiven zu ermöglichen, gehen wir nach dem Input in ein World-Café.
Workshop: Klasse - Ausstellen
Workshopleitung: Joachim Baur (TU Dortmund / Die Exponauten) & Doreen Mölders (Historisches Museum Frankfurt)
Referent*innen: Alexander Renz & Imke Volkers (Werkbundarchiv – Museum der Dinge, Berlin) und Anna-Lena Wenzel (freie Autorin und Vermittlerin, Berlin)
Ausstellungen werden oft als Schauseite und öffentliches Gesicht des Museums beschrieben. Was gibt es dort zu sehen, was geben sie preis? Perspektiven auf Klasse spielten zu verschiedenen Zeiten eine relevante Rolle im Ausstellen. Nach Jahren der De-Thematisierung wurden sie zuletzt in einigen Versuchen erneut in den Vordergrund gerückt.
Hier setzt der Workshop an: Mit Inputs aus den Ausstellungsprojekten “Klassenfragen – Kunst und ihre Produktionsbedingungen” (2022/23) und “Milieudinge - von Klasse und Geschmack” (2025/26) nähern wir uns Ansätzen, wie Ausstellungen Klasse und Klassismus repräsentieren (können). Zugleich fragen wir uns, welche Klassenpositionen im Ausstellen als kollektive Arbeit zusammenkommen und wie sie verhandelt werden.
Teilnehmende sind dazu aufgerufen, aus ihren fachlichen, institutionellen, aktivistischen und sonstigen Kontexten Ideen mitzubringen, wie Fragen von Klasse und Klassismus im Kontext von Ausstellungen thematisiert werden können. Neben den Inputs und ihrer Diskussion werden diese Ideen - vielleicht mögliche Projekte? - im Mittelpunkt unseres Austauschs stehen.
Katharina Böttger

Geboren und aufgewachsen in Frankfurt am Main, stellte sie sich von klein an viele Fragen zum Zusammenleben in der Stadt. Themen rund um die (un-)gerechte Stadt wurden dann wichtiger Bestandteil ihres Studiums (Humangeographie in Frankfurt am Main und Urban Design in Hamburg) und schließlich ihrer Berufspraxis als freie Kuratorin und Stadtforscherin.
Ihr Interesse gilt der Wissensvermittlung von urbanen Prozessen und Phänomenen an der Schnittstelle von Architektur, Urbanismus, Kultur und Kunst mit der Frage: Wer produziert das Bild der Stadt?
Zuletzt kuratierte sie in Teams die Ausstellungen „Alle Tage Wohnungsfrage. Vom Privatisieren, Sanieren und Protestieren“ (Stadtlabor, HMF), „Stadt der Fotografinnen. Frankfurt 1844-2024“ (HMF) und „Nichts Neues. Besser Bauen mit Bestand“ (DAM).
Alexander Gallas

ist Politikwissenschaftler und wurde 1976 in Bonn geboren. Ab Mitte der 1990er studierte er, erst an der FU Berlin, dann an der Lancaster University. Bereits damals befasste er sich mit Arbeitskämpfen und Klassentheorie und war Mitglied einer Initiative, die Selbstorganisierungsprozesse von Callcenterbeschäftigten unterstützte. Ab 2004 promovierte er dann in Lancaster. In seiner Arbeit – unter dem Titel The Thatcherite Offensive 2015 bei Brill erschienen – ging es darum, wie die Regierungen von Margaret Thatcher und John Major die Klassenverhältnisse in Großbritannien reorganisiert haben. 2013 wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Kassel. Er beteiligte sich an der statusgruppenübergreifenden Kampagne ‚Uni Kassel Unbefristet‘, die sich gegen prekäre Arbeit auf dem Campus richtete. 2024 wurde sein zweibändiges Buch Exiting the Factory: Strikes and Class Formation beyond the Industrial Sector von Bristol University Press veröffentlicht. Seit April 2025 ist er Professor für die Organisation und Transformation wohlfahrtsstaatlicher Sicherungssysteme an der Frankfurt University of Applied Sciences.
Nina Gorgus
Die Frage, die Nina Gorgus oft beantworten musste: Was willst Du denn mit dem Studium Empirische Kulturwissenschaft (Französisch und Soziologie) eigentlich mal anfangen? führte schon sehr früh direkt zum Museum, denn dieses war in der Studienbeschreibung als ein mögliches Berufsfeld genannt und eine Antwort, die alle zufriedenstellte. Nach vielen (Museums-)Stationen ist Nina Gorgus seit 2010 am Historischen Museum Frankfurt, zunächst als Koordinatorin und Ko-Kuratorin der Dauerausstellung Frankfurt Einst?. Seit 2012 betreut sie die Sammlungen Alltagskultur II und Spielzeug, Kindheit- und Jugendkultur und seit 2024 die Abteilung Sammlung und Forschung. Ihre letzten Ausstellungen (Frankfurter Gartenlust 2021, Bewegung! 2024) am HMF beschäftigten sich mit zentralen Fragen der Gegenwart, die Geschichte, Alltagskultur und den urbanen Raum miteinander verknüpfen. Seit 2023 ist sie Honorarprofessorin am Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft an der Uni Tübingen.
Alexandra Henning
Alexandra Hennig (she/ihr), geb. 1989 in Ostberlin, ist eine weiße, nicht-behinderte, hörende Person. Alex arbeitet seit der Spielzeit 2022/23 als Dramaturgin im Team Programm und Begegnung am Künstler*innenhaus Mousonturm, Frankfurt am Main sowie für die Tanzplattform Rhein-Main.
Sie war zuvor als freischaffende Dramaturgin, Kuratorin und Journalistin in der freien Theaterszene Berlins tätig. Als Journalistin schrieb sie u.a. für die Zeitschrift Tanz, für das tanzraumberlin Magazin und die Berliner Zeitung. Als Dramaturgin arbeitet sie u.a. zu Themen von Asthetics of Access, Embodiment, (post)kolonialem Erbe, Archiv und Humor. Sie leitete das Artist Lab „Witzigkeit kennt seine Grenzen – Klassismus und Humor in den Darstellenden Künsten“ gemeinsam mit Hendrik Quast als Teil der Bundesweiten Artist Labs, gefördert durch den Fonds Darstellende Künste. Seit 2023 co-kuratiert Alex gemeinsam mit Anna Wagner und Bruno Heynderickx das Tanzfestival Rhein-Main.
Susanne Gesser
stammt aus einer alten Handwerkerfamilie, Abitur und Studium waren für sie nicht vorgesehen. Dennoch hat ihre Familie sie unterstützt, auch wenn sich niemand vorstellen konnte, wie man sich mit dem Studium (Kunstpädagogik, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften, Erziehungswissenschaften) seinen Lebensunterhalt wird verdienen können. Während des Studiums machte Gesser ein Praktikum im Kindermuseum Frankfurt (heute Junges Museum) und arbeitete freiberuflich als Kulturvermittlerin in verschiedenen Museen von Hamburg bis München.
Susanne Gesser ist seit 1992 Kuratorin am Historischen Museum Frankfurt. Sie leitet das Junge Museum Frankfurt und die Abteilung Vermittlung und Partizipation und ist stellvertretende Direktorin am HMF. Im Rahmen der Neukonzeption des Museums legte sie den Grundstein für die Dauerausstellung Frankfurt Jetzt! mit dem partizipativen Ausstellungsformat Stadtlabor.
Susanne Gesser ist Gründungsmitglied des Bundesverbandes Museumspädagogik e.V. sowie des Bundesverbandes der Deutschen Kinder- und Jugendmuseen e.V. (Vorstandsmitglied von 1997 bis 2000 und 2015 bis 2017). Sie ist Vizepräsidentin von Hands On! International Association of Children in Museums und Jury Mitglied des internationalen Children in Museums-Award.
Angela Jannelli
Angela Jannelli ist in einer italo-deutschen Familie aufgewachsen. Wichtige Räume ihrer Kindheit waren ein Hochhaus am Rand der schwäbischen Alb, ein Autohaus, Omis Gute Stube und das Gymnasium, ein Einfamilienhaus mit Rasen, der schon nach kurzer Zeit in einen Acker verwandelt wurde, und viele Gastarbeiter-Wohnungen. Ihre Welt vergrößerte sich signifikant durch Bücher, Theater- und Museumsbesuche sowie ein kultur- und geisteswissenschaftliches Studium. Mit der Entdeckung der Empirischen Kulturwissenschaft fand sie ein Zuhause für ihren neugierigen Geist und einen Weg, das rätselhafte Verhalten von Menschen zu erkunden. Das Museum lag buchstäblich auf ihrem Weg: Eines Abends blieb sie auf dem Heimweg vor dem Altonaer Museum stehen und sagte sich: Das könnte doch eigentlich auch ein Arbeitsplatz für mich sein! Seitdem arbeitet Angela in und für Museen und hat sich auf partizipative Museumsarbeit spezialisiert. 2010 kam sie für die Neukonzeption der Dauerausstellungen ans HMF (Schneekugel und Frankfurt Jetzt! mit dem Stadtlabor). Seit 2012 ist die Kuratorin der Bibliothek der Generationen.
Ilija Matusko
Ilija Matusko (*1980 in München) ist Schriftsteller und Soziologe – und vermutlich einer der wenigen Autoren, die von sich behaupten, das Bierzapfen besser zu beherrschen als das Schreiben. Matusko wuchs mit Pommes und Ćevapčići auf, seine Eltern betrieben eine Gastwirtschaft in Bayern. Die Frage, ob der Geruch von Bratfett die eigene soziale Herkunft verrät, wurde für ihn zum Ausgangspunkt seiner Essays. Heute lebt er in Berlin und beschäftigt sich in seiner Arbeit mit sozialer Herkunft, Klassenfragen und Identität.
Doreen Mölders
Mit dem 9. November 1989 änderte sich ihre bereits geplante Zukunft. Anders als gedacht, wechselte sie 1991 von der DDR-Einheitsschule POS ans Gymnasium. Danach studierte sie als Erste in ihrer Arbeiterfamilie: Archäologie und Geschichte an den Universitäten Leipzig und Freiburg i. Br.. Im Laufe der Zeit erwarb sie Fachexpertise, kulturelle und politische Bildung und dachte viel über den Systemwechsel und Gesellschaftstheorien nach.
Die meisten Karriereschritte nach dem Studienabschluss passierten ihr ohne Vorwissen und Planung: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Archäologie, danach Promotion – weil es hieß, dass man die braucht. Dann Kuratorin am Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz und damit das erste Mal das Gefühl: 100 Prozent richtige Wahl. Museum sollte es also sein. Deshalb absolvierte sie eine Weiterbildung für Museumsmanagement und ist seit 2019 Museumsleitung, erst am Westfälischen Landesmuseum für Archäologie und Kultur und seit 2025 am Historischen Museum Frankfurt.
Stefan Müller
PD Dr. Stefan Müller. Nach Berufsausbildung und -tätigkeit als Drucker studierte er Politikwissenschaft an der FU Berlin. Mit der Promotion wandte er sich der Geschichtswissenschaft zu. Seine Arbeits- und Interessenschwerpunkte sind die Labour History und die Oral History. Seit 2013 arbeitet er im Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung und seit 2022 leitet er dort das Referat Public History.
Alexander Renz
merkte im Laufe seines Lebens, dass die Formulierung „Geboren und aufgewachsen in Konstanz am Bodensee“ häufig assoziiert wird mit „wohlhabend sein“. Musste diesbezüglich einige Leute enttäuschen. Nach seinem Studium der Politik- und Empirischen Kulturwissenschaft in Tübingen forschte er fünf Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ludwig-Uhland-Institut zu szenografischen Museumsausstellungen. Den anschließenden Umzug nach Berlin bereute er zu seiner eigenen Überraschung nicht, auch weil er im Werkbundarchiv – Museum der Dinge landete. War dort während und vor allem im Anschluss an sein Volontariat kuratorisch aktiv, zuletzt bei „Profitopolis oder der Zustand der Stadt“ und mit „Milieudinge – von Klasse und Geschmack“. Alexander Renz beobachtet die Geldanlagepläne und -praxis von Gleichaltrigen mit Interesse und fragt sich, ob es mit seiner Herkunft oder der Berufswahl zu tun hat, dass er eine gewisse Distanz dazu hat.
Johanna Sänger
Kulturhistorikerin. Seit 2012 Kuratorin für Stadt- und Landesgeschichte ab 1800 am Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig.
Ausbildung zur Chemiefacharbeiterin und zwei Semester Chemiestudium. An der Universität Jena Studium der Germanistik sowie Kulturgeschichte. Promotion zu den Straßennamen der DDR. 1999 erste Ausstellung zur DDR-Stadtplanung in Jena. Seit 2005 wissenschaftliche Mitarbeiterin in Museen in Berlin (zuständig für Sammlungen zu DDR-Design und –Alltagskultur) und Leipzig. Hier zahlreiche Ausstellungen zur Transformations- und Zeitgeschichte Leipzigs, vor allem zur jüdischen Geschichte, Nationalsozialismus und DDR sowie Industriekultur.
Francis Seeck
Francis Seeck ist Professor*in für Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Demokratie- und Menschenrechtsbildung an der TH Nürnberg. Seeck studierte Kulturwissenschaften an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) sowie Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, wo Seeck auch mit einer ethnographischen Studie zu queerer Sorgearbeit promovierte. Francis Seeck forscht und lehrt zu Klassismuskritik, diskriminierungskritischer Politischer Bildung, Gender und Queer Studies, sowie menschenrechtsorientierter Sozialer Arbeit. Seit vielen Jahren in der Antidiskriminierungspädagogik tätig, verbindet Seeck wissenschaftliche Forschung mit pädagogischer Praxis. Zu den jüngsten Publikationen zählen "Zugang verwehrt" (Atrium 2022), "Klassismus überwinden" (Unrast 2024) und der Sammelband "Klassismuskritik und Soziale Arbeit" (Beltz Juventa 2024).
Imke Volkers
ist Kunst- und Kulturwissenschaftlerin. Nach ihrer Tätigkeit am Deutschen Hygiene-Museum Dresden und als freie Kuratorin arbeitet sie seit 2005 am Werkbundarchiv – Museum der Dinge in Berlin, seit 2023 in der Funktion der Wissenschaftlichen Co-Leitung. Ihr Interesse gilt Konzepten, mit denen Dinge verstanden, erfasst und gedeutet werden können, insbesondere ihrer Rolle als Ausdruck ästhetischer, ökonomischer, psychologischer und gesellschaftspolitischer Interessen. Diese Perspektiven prägen auch ihre kuratorische Praxis, etwa in Ausstellungen wie Böse Dinge. Eine Enzyklopädie des Ungeschmacks (2009), Object Lessons (2016), The Story of My Life. Objektbiografie als Konzept, Methode und Genre (2023) oder zuletzt gemeinsam mit Alexander Renz Milieudinge – von Klasse und Geschmack (2025/26). Sie ist ständiges Jurymitglied des RecyclingDesignpreises Deutschland.
Anna-Lena Wenzel
ist Kulturwissenschaftlerin und arbeitet als freiberufliche Autorin und Vermittlerin in Berlin. 2022/23 hat sie die Ausstellung Klassenfragen – Kunst und ihre Produktionsbedingungen co-kuratiert. In ihren Texten und Interviews denkt sie stets die prekären Arbeitsbedingungen und Machtverhältnisse des Kulturfeldes mit, während sie als Mitbetreiberin des Kleinen Raum für aktuelles Nichts die Auf- und Abwertungsprozesse innerhalb des Kunstfeldes untersucht hat. In einer Familie von Bildungsaufsteigern aufgewachsen, kennt sie die Sprachlosigkeit, die mit diesem Aufstieg einhergehen kann. Weil sie die akademische Diskurse oft als ausschließend empfindet, beschäftigt sie sich in ihrer Arbeit vorzugsweise mit dem Alltäglichen (u.a. hat sie eine Trilogie der Beziehungen mit Bänden zu Liebe, Herzschmerz, Freundschaft veröffentlicht) und interessiert sich sehr für den öffentlichen Raum (seit 2012 betreibt sie das Online-Stadtmagazin 99% Urban).
Karolina Dreit, Kristina Dreit „Working Class Daughters. Über Klasse sprechen“
Karolina Dreit ist Arbeiter:innenkind und Post-Ost-Migrantin. Sie studierte u. a. Erziehungswissenschaften und Soziologie und ist als Kulturarbeiterin und Lehrerin tätig. Sie interessiert sich für Arbeitskämpfe, undogmatische Perspektiven auf Klasse und verbindende politische Praktiken.
Kristina Dreit ist Künstlerin und Forscherin. Sie studierte Critical Studies und Performative Künste an der Akademie der bildenden Künste Wien und interessiert sich für die Verschränkungen von Körper, Klasse und Geschlecht, sowie sensorische und choreografische Zugänge zu Arbeit und Werkzeugen.
Seit 2018 arbeiten Karolina Dreit und Kristina Dreit gemeinsam unter dem Titel Working Class Daughters und befragen Klassenverhältnisse an der Schnittstelle von Sorge, Struktur und Erfahrung. In wechselnden Kooperationen entwickeln sie Performances, Installation und Interventionen im öffentlichen Raum. In ihrem 2024 erschienenen Buch „Working Class Daughters. Über Klasse sprechen“ (Mandelbaum Verlag) behaupten sie eine Wirklichkeit, in der das Sprechen über Klasse nicht von Scham und Isolierung getragen wird, sondern nach Verbindungen und Klassenbewusstsein sucht.
